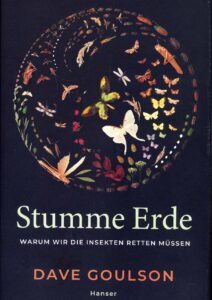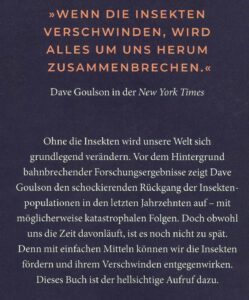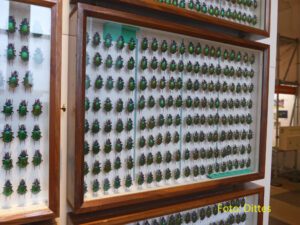Der erste Fund wurde dem BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) Bretten im April 2019 aus Oberderdingen gemeldet. Ein Jahr später schickte ein Betroffener aus dem Raum Heidelberg, der von einer Spinne gebissen worden war, das erste Belegfoto.
Der erste Fund wurde dem BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) Bretten im April 2019 aus Oberderdingen gemeldet. Ein Jahr später schickte ein Betroffener aus dem Raum Heidelberg, der von einer Spinne gebissen worden war, das erste Belegfoto.
(siehe dazu auch unseren Artikel vom Oktober 2020)
„Inzwischen haben sich beim BUND mehrere aufmerksame Leser gemeldet, die Bekanntschaft mit der Kräuseljagdspinne ( Zoropsis spinimana) gemacht haben“, weiß Matthias Menzel vom BUND.
In Bretten ist diese Spinne offensichtlich heimisch geworden. Nicht nur in Gärten und Garagen, sondern auch in Wohnhäusern hat sie sich inzwischen niedergelassen. So wurden kürzlich in der Brettener Innenstadt innerhalb weniger Tage gleich acht erwachsene Spinnen in Treppenhaus und Badezimmer entdeckt.
Diese Spinne, die sich in den letzten drei Jahrzehnten von den Mittelmeerländern über die Alpen bis zu uns in den Kraichgau ausgebreitet hat, kann eine Körperlänge von fast zwei Zentimetern erreichen. Ihre ausgestreckten Beine haben eine Spannweite von bis zu fünf Zentimetern.
An ihren Beinspitzen besitzt sie feine Haarbüschel mit mikroskopisch kleinen Hafthaaren mit bürstenartigen Enden. Damit kann sie mühelos sogar an senkrechten Glaswänden hochklettern.
Die Grundfärbung ist sehr variabel, von gelblich über grau bis zu dunkelbraun mit einer dunklen Zeichnung auf der Oberseite. Diese soll dem Vampir aus dem Film Nosferatu ähneln. Daher auch die Bezeichnung „Nosferatuspinne“.
Ihre Beute, meistens Insekten, aber auch andere Spinnen, wird im Sprung blitzschnell überwältigt und durch einen Giftbiss getötet.
Fühlt sich die Spinne bedroht, richtet sie ihren Körper auf und spreizt ihre nadelspitzen Giftklauen. Ihr Biss ist zwar für Menschen ungefährlich, aber doch schmerzhaft wie ein Wespenstich.
Diese Spinne baut kein Fangnetz, obwohl sie Fäden produzieren kann. Diese Kräuselfäden werden zu einer Schutzhülle des Eigeleges, das bis zu hundert Eier enthalten kann, verwoben. Die Weibchen kümmern sich um ihren Nachwuchs. Sie bewachen den Eikokon mit den geschlüpften Jungspinnen.
Der BUND bittet darum, Funde hier bei der deutschen Arachnologischen Gesellschaft zu melden.