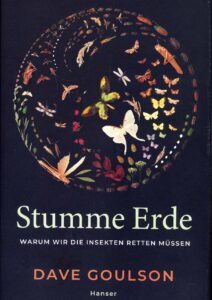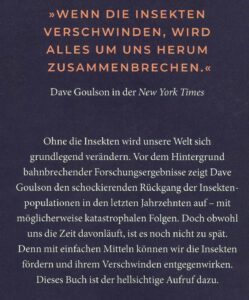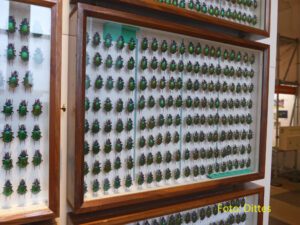Internationaler Weltbodentag am 5. Dezember
 Fruchtbare Ackerböden sind die Grundlage für unser tägliches Brot und die Existenzgrundlage für landwirtschaftliche Betriebe. Doch leider geht unsere Gesellschaft rücksichtslos mit dieser unersetzlichen Ressource um. Böden werden zubetoniert und mit Schadstoffen vergiftet.
Fruchtbare Ackerböden sind die Grundlage für unser tägliches Brot und die Existenzgrundlage für landwirtschaftliche Betriebe. Doch leider geht unsere Gesellschaft rücksichtslos mit dieser unersetzlichen Ressource um. Böden werden zubetoniert und mit Schadstoffen vergiftet.
Bretten liegt im Kraichgau, der besonders fruchtbare Lößböden besitzt. Auch diese sind schädlichen Einflüssen ausgesetzt, wie zum Beispiel der flächenhaften Abschwemmung bei Starkregen.
Voraussetzung für diese Bodenschädigung sind die zum Teil steilen Hügel im Kraichgau, der Anbau von spät ein Blätterdach entwickelnden Feldfrüchten wie Mais und Rüben. Ohne schützende Blätter prallen die Regentropfen auf den unbedeckten Boden, reißen diesen auf, das abfließende Wasser spült die fruchtbare Erde ab und entwurzelt die noch kleinen Pflänzchen.
Der Bodenverlust bei einem Wolkenbruch kann mehr als 400 Tonnen Erde pro Hektar betragen. Durch den Klimawandel werden solche Ereignisse immer häufiger. Zwar versuchen die Landwirte mit schonender Bodenbearbeitung und dem Anbau von Zwischenfrüchten den Bodenabtrag zu verringern, trotzdem wird die Bodendecke von Jahr zu Jahr dünner. Bei Regenwetter sieht man an den braun gefärbten , Hochwasser führenden Bächen Salzach und Saalbach, wie der fruchtbare Boden unwiederbringlich ins Meer abtransportiert wird.
Zusätzlich werden unsere Ackerböden versiegelt. So sind allein auf der Gemarkung Bretten in den letzten Jahren mehr als 300 Hektar Ackerflächen für Wohn- und Gewerbeflächen und Straßenbau unter Beton und Asphalt verschwunden.
„Im Zuge der Fortschreibung des Regionalplanes sollen in den kommenden Jahren in den Gemeinden der Region Karlsruhe 20 000 Hektar landwirtschaft-licher Nutzflächen sogenannten Siedlungserweiterungsflächen zum Opfer fallen, davon allein 100 Hektar auf der Gemarkung Bretten“ , betont Hartmut Weinrebe vom BUND Regionalverband Mittlerer Oberrhein. Dies führt zum Verlust landwirtschaftlicher Erträge. Versiegelte Fläche werden sich bei jedem sonnigen Tag aufheizen und so den Klimawandel beschleunigen. Deshalb fordert der BUND seit Jahren keine Äcker und Wiesen mehr zu versiegeln.
Nach Angaben des Umweltbundesamtes gehen jährlich weltweit etwa 10 Millionen Hektar Ackerfläche verloren. Auf einem Viertel der globalen Bodenfläche haben der Humusgehalt und damit die Erntemengen drastisch abgenommen.
Dabei sind fruchtbare Böden die Voraussetzung für eine sichere und ausreichende Nahrungsmittel-versorgung. Deshalb wurde der 5. Dezember von der Internationalen Bodenkundliche Union (IUSS) zum Weltbodentag erklärt. Damit wird seit 2002 jährlich weltweit ein Zeichen für die Bedeutung der unersetzlichen natürlichen Ressource Boden gesetzt.
Links zu Hochwasser / Erosion Ruit:
17.09.2019 Überschwemmungen als Folgen des Klimawandels
16.06.2016 Überschwemmung in Bretten Ortsteil Ruit 2016
20.06.2015 Hochwasser Juni 2015
UmweltBundesAmt: Weltweit gehen jährlich 10 Millionen Hektar Ackerfläche verloren